The Running Man
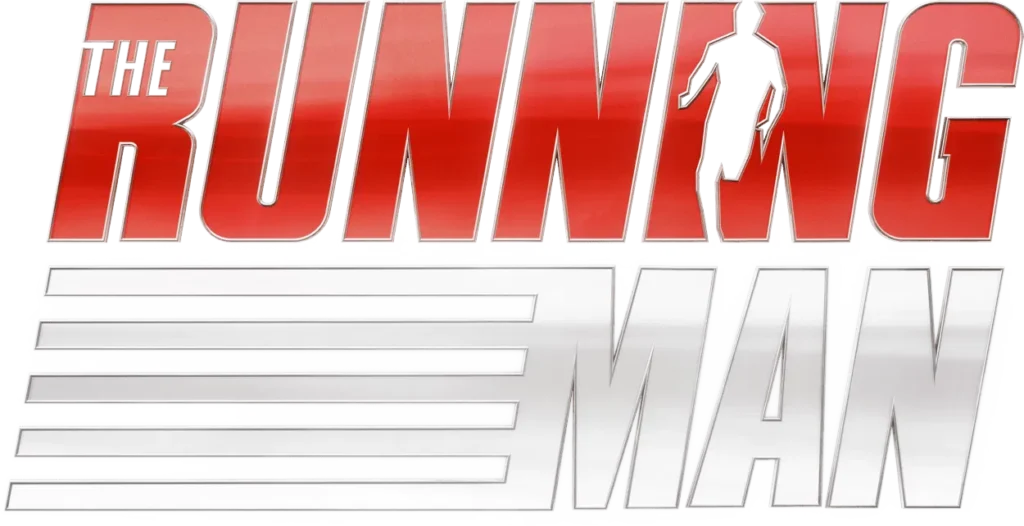
The Running Man wurde mittlerweile mehrfach neu erzählt, umgeformt und verändert. Neben dem Buch, dass 1982 erschien, gibt zwei noch Filme und alle Fassungen unterscheiden sich teils Eklatant, teils nur in Nuancen voneinander. Drei Werke, ein gemeinsamer Kern und trotzdem völlig verschiedene Antworten auf dieselbe Frage.
Was mich dabei beschäftigt hat, ist nicht, welche Version besser ist, sondern warum jede Variante den Wert eines Menschen anders verhandelt. Warum die Romanfassung Ben Richards in einem hoffnungslosen Überlebenskampf zeigt, warum die Achtzigerjahre ihn zur Action-Ikone machen und warum die neue Verfilmung eine mediale Identitätsvernichtung ins Zentrum rückt.
Darum gibt es hier nun meine Perspektive darauf, wie diese drei Geschichten denselben Stoff aufgreifen und doch völlig andere Schwerpunkte setzen.
Die richtige Frage
Im Mittelpunkt aller drei Fassungen steht ein Mann, der gegen ein übermächtiges System kämpfen muss, das Menschen nur noch als verwertbare Masse betrachtet. Eine Gesellschaft, die Unterhaltung mit realer Gewalt gleichsetzt und ein mediales Konstrukt, das seine eigene Wahrheit nach Bedarf formt. Ein Amerika, das in den beiden Werken der 1980er noch als absurde Dystopie gezeichnet wurde und heute, vor allem in der Neufassung, gar nicht mehr so unrealistisch wirkt.
Je länger ich mich mit allen drei Varianten beschäftigt habe, desto deutlicher wurde mir, dass es hier nicht einfach um unterschiedliche Versionen derselben Geschichte geht, sondern um unterschiedliche Antworten auf die Frage, wie man zeigt, was ein Mensch wert ist, wenn eine Gesellschaft ihn entmenschlicht. Und je weiter wir uns von Stephen Kings bitterer Vorlage entfernen, desto bequemer scheinen diese Antworten zu werden.
Totale Erschöpfung
Kings Welt ist dreckig, niederträchtig und erschöpfend. Die Luftverschmutzung ist eine reale Gefahr, die soziale Kälte ist allgegenwärtig, medizinische Versorgung ist ein Luxus. Ben Richards nimmt am Running Man nicht teil, weil er etwas verändern will, sondern weil er überhaupt keine Wahl hat. Seine Tochter ist todkrank, seine Frau ist am Ende und das der einzige Ausweg irgendwie an genug Geld zu kommen, um seiner Tochter die notwendige Behandlung zu bezahlen und seiner Frau nicht mehr zu muten zu müssen, das Geld weiter in der Horizontalen zu verdienen.
Die Teilnahme an der Sendung ist quasi sein letzter, verzweifelter Versuch, seiner Familie irgendwie zu helfen. Die Menschenjagd selbst ist keine Show im klassischen Sinn, sondern eher ein landesweites Fahndungsprogramm. Richards bekommt ein Startgeld, eine Kamera und einen Vorsprung, danach jagt ihn das ganze Land. Nicht aus Bosheit, sondern aus Armut. Das macht Kings Welt so glaubwürdig und zugleich so gnadenlos.
King beantwortet die Kernfrage kalt: Ein Mensch ist nur so viel wert wie der Preis, den das System für ihn auslobt. Im letzten Akt kommt es quasi zur Selbstaufgabe und ein aller letztes Aufbäumen. Diese Aktion der Selbstzerstörung ist in der geschaffenen Welt aus Richards Sicht folgerichtig und unumgänglich, bringt aber keine nachhaltige Lösung. Es ist zwar ein Zeichen des Widerstands, allerdings scheint er keinerlei Konsequenz, gar eine Rebellion zu wecken, sondern ist nur ein letztes Aufbäumen eines Mannes, der längst alles verloren hat.
Genau an diesem Punkt biegt die erste Verfilmung von 1987 komplett anders ab.
I’ll be back
Wenn man direkt nach dem Roman die Schwarzenegger-Version sieht, fühlt sich das fast wie eine 180° wende, mindestens aber wie ein Genrewechsel an. Wo Kings Roman den Wert eines Menschen im verzweifelten Überlebenswillen misst, definiert der 87er Film ihn über körperliche Stärke, Coolness und mediale Präsenz.
Hier ist Richards ein unschuldig verurteilter Ex-Polizist, die Show ein grelles TV Spektakel, die Gegner tragen Namen wie Subzero, Buzzsaw und Dynamo und sehen aus wie fleischgewordene Comicfiguren. Das ist keine Systemkritik mehr, das ist Popkultur.
Aus meiner Sicht heraus muss ich ehrlich sagen, funktioniert das in seiner eigenen Logik auch sehr gut. Der Film ist schrill, dreist, überzeichnet und absolut ein Produkt seiner Zeit. Als King Adaption taugt er hingegen fast gar nicht, aber als Achtzigerjahre Actionfilm funktioniert er bis heute erstaunlich gut.
Man merkt dem Film allerdings auch an, dass er weniger an Kings Geschichte interessiert war als an der Möglichkeit, Schwarzenegger als Marke zu inszenieren. Viele Szenen wirken so, als seien sie nicht entwickelt worden, um Richards als Figur zu vertiefen, sondern um Schwarzenegger einen weiteren Heldenmoment zu geben. Die Show, die Jäger, die vielen für die Zeit typischen Oneliner, all das passt deutlich stärker zu Arnies damaligem Kinoimage als zur Buchvorlage. In gewisser Weise erzählt der Film also gar nicht The Running Man, sondern The 80’s Action Movie.
Um auf die die ursprüngliche Frage zurück zu kommen, wäre die Antwort hier wohl, dass die Entmenschlichung hier nicht ökonomisch stattfindet, sondern eher ästhetisch. Gewalt wird zur Show, der Tod ein Unterhaltungsfaktor, ein reines Spektakel im Sinne von Brot und Spiele.
Dass der Film damals in Deutschland indiziert wurde, wirkt im Rückblick fast ironisch, gerade wenn man bedenkt, wie gnadenlos der Roman ist. Heute ist er sogar bereits ab 16 Jahren freigegeben, was auch zeigt, wie selbst unsere Realität immer härtere Gewalt akzeptiert hat.
Die Neuinterpretation
Der neue Film von Edgar Wright findet eine Zwischenposition. Er übernimmt Kings Grundgefühl, aber setzt es in eine moderne Medienwelt, die sich nicht mehr auf Studios beschränkt. Drohnen, Livestreams, Deepfakes, algorithmische Hetze. Richards wird nicht nur gejagt, er wird gleichzeitig medial umgeschrieben. Seine Identität steht genauso auf dem Spiel wie sein Leben.
Glen Powell trägt diese Version, aber nicht ohne Reibung. Er ist präsent, charismatisch und glaubwürdig in der Action. Aber ich finde, dass ihm oft ein Lächeln zu viel im Gesicht steht. Ein Moment zu viel Selbstsicherheit. Ein Hauch zu viel „Glen Powell“.
Und genau das passt wiederum merkwürdig gut zu dem, was der Film zeigt, nämlich eine Welt, in der selbst der existenzielle Kampf noch wie Performance wirkt. Eine Entmenschlichung, die nicht über Gewalt läuft, sondern über die Glätte der Oberfläche. Eine Parallele die wir auch heute schon in unserer Social Media Welt erleben können, wenn wir nur hinschauen.
Trotzdem hätte ich mir insgesamt mehr Härte gewünscht. Wrights Film ist zwar schonungslos und zeigt recht viel, aber geht in manchen Momenten dann doch zu wenig dahin wo es weh tut. Vor allem das Ende bleibt mir zu versöhnlich. Das System bekommt zwar Risse, aber es fällt nicht. Und der kurze Ausflug in Richtung anonymer Netzaktivisten wirkt wie ein thematischer Umweg, der die klare Aussage eher verwässert und Wasser auf die Mühlen der Falschen Leute sein könnte.
Gerade weil der Film so viele Mechaniken der modernen Medienwelt treffend zeigt, hätte ich mir gewünscht, dass er sie am Ende genauso konsequent zu Ende denkt.
Jedes Werk ein Kind seiner Zeit
Wenn ich alle drei Versionen nebeneinander lege, entsteht eigentlich kein Ranking, sondern ein Spannungsfeld. Der Roman ist bitter, unbequem und konsequent. Der 87er Film ist laut, grell und unterhaltsam. Der neue Film ist reflektiert, aktuell, aber auch vorsichtiger und weitaus weniger progressiv, als er auf den ersten Blick wirken mag.
Und vielleicht ist genau das der Punkt. Je weiter wir uns zeitlich von Kings Vorlage entfernen, desto stärker verschiebt sich die Verantwortung vom System auf die Individuen. Vom Überleben, über das Kämpfen bis hin zum Inszenieren. Was früher wie Warnung wirkte, fühlt sich heute eher wie ein Kommentar an. Nicht, weil die Geschichten braver geworden sind, sondern weil unsere Welt näher an diese Fiktion herangerückt ist.
The Running Man ist für mich genau deshalb interessant. Nicht, weil eine der Versionen die „richtige“ wäre, sondern weil jede etwas über die Zeit verrät, aus der sie kommt. Ich frage mich, wie die Geschichte wohl in 10, 15 oder 20 Jahren aussehen würde.
Bevor ich zum Ende komme, möchte ich noch etwas ansprechen, das mir beim Schreiben dieses Beitrags aufgefallen ist. Dieser Text, den ihr bis hier hin gelesen habt, hat selbst mehrere Anläufe gebraucht. Ich habe immer wieder neu angefangen, verworfen, umsortiert und dann doch wieder alles über den Haufen geworfen. Anfangs dachte ich, ich müsste eine klare Struktur finden, um diesen drei Fassungen gerecht zu werden. Doch je länger ich daran saß, desto mehr merkte ich, dass es genau darum auch im Stoff selbst geht. The Running Man lässt sich nicht leicht in eine Form pressen und vielleicht war mein ständiges Umstellen und Neuordnen nur ein kleiner Spiegel davon. Eine Geschichte, die sich so oft verwandelt hat, zwingt einen dazu, selbst flexibel zu bleiben.
Abschließend kann ich nur sagen: schaut euch The Running Man an, egal ob im Kino, auf Blu-ray, 4K UHD oder im Stream. Lest das Buch Menschenjagd, wenn ihr die härteste Version des Stoffs erleben wollt oder hört euch das Hörbuch von David Nathan an. Wer den Weg durch alle Fassungen gehen möchte, kann sich zum Schluss auch den 87er Film geben, dieser ist aktuell am einfachsten im Stream verfügbar, weil die Blu-ray kaum noch zu bekommen ist. Nehmt euch danach vielleicht einen Moment, um zu überlegen, wie viel Fiktion in dieser Dystopie heute eigentlich noch steckt.
Was ist eure Meinung Habt ihr den neuen Film schon gesehen, schwört ihr auf den Arnie Streifen oder sagt ihr, nur das Buch trifft den richtigen Ton Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen.
















Kommentar verfassen